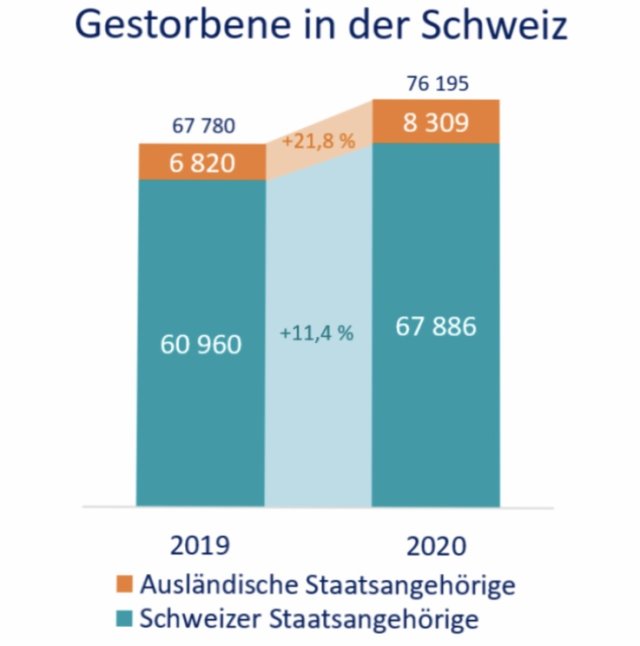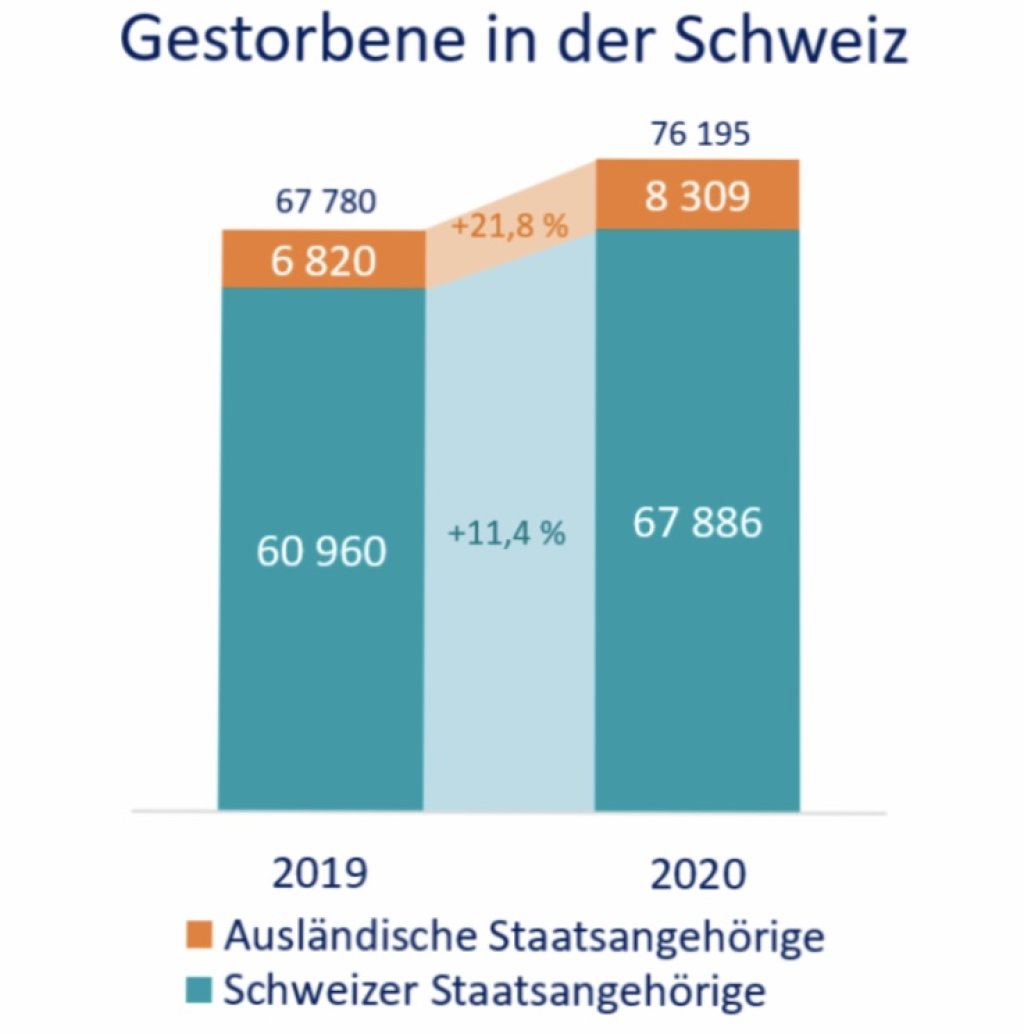Innovation
Vor Gericht die Schweizer Migrationspolitik ändern? Eine Debatte über Möglichkeiten und Grenzen des Rechtswegs zur Erreichung politischer Fortschritte
Thursday, 19. May 2022
Posted by Fanny de Weck & Tarek Naguib


Fanny de Weck und Tarek Naguib diskutieren über die Möglichkeiten und Grenzen des Rechts im Kampf um ein Ausländer-, Asyl- und Bürgerrecht frei von Willkür und dafür mehr Gerechtigkeit. Dabei sind sie sich nicht immer einig, was mit einem Rechtsstreit vor Gericht erreicht werden kann und was nicht: wo seine Potenziale und wo seine Grenzen liegen? Letztlich geht es ihnen aber beiden darum, dass die Grund- und Menschenrechte von Menschen mit Migrationsgeschichte und Rassismuserfahrung auch umgesetzt werden - und dafür muss gekämpft werden.
Gemeinsame Vorbemerkung
Welche Möglichkeiten einer gerechten Teilhabe haben Menschen ohne Schweizer Pass in einem Land, dessen Verfassung einerseits die Rechtsgleichheit als Grundrecht verankert, andererseits aber zwischen «Staatsangehörigen» und «Ausländern» unterscheidet? Lässt sich die Justiz «nutzen», um rassistische Ausgrenzung und Diskriminierung zu bekämpfen, wo doch das Recht gleichzeitig auch der Abwehr von Menschen aufgrund ihrer tatsächlichen oder zugeschriebenen Herkunft dient und solche Diskriminierung legitimiert? Ist das Schweizer Recht das, was die Bundesverfassung verspricht, nämlich ein Rahmen der «Freiheit und Demokratie» – oder aber ein Instrument des Ausschlusses?
Das folgende Gespräch dreht sich um unser Ringen als Juristin und Jurist darum, dass ein und dasselbe Recht für alle gilt. Wir setzen uns beide für die Rechte von Menschen mit Migrationsgeschichte und Rassismuserfahrung ein. Fanny de Weck als Anwältin mit Schwerpunkt Migrationsrecht, Strafrecht und internationaler Menschenrechtsschutz; Tarek Naguib als Forscher und Aktivist, der strategische Rechtsverfahren gegen strukturelle Diskriminierung begleitet. Wir stimmen darin überein, dass Rechte haben und Recht bekommen zweierlei Realitäten des Rechtsstaats sind. Selbstverständlich wissen wir, dass Recht nicht mit Gerechtigkeit gleichzusetzen ist. Zudem sind wir beide der Ansicht, dass das Recht nicht nur Elemente der Ohnmacht und Ausgrenzung in sich trägt, sondern auch Spielräume für mehr Gerechtigkeit eröffnen kann.
Allerdings sind wir uns manchmal uneinig, was ein Rechtsstreit leisten kann und was nicht: wo seine Potenziale und wo seine Grenzen liegen. Fanny legt den Fokus auf den Rechtsschutz und individuelle Rechtsverfahren; sie steht der Justiz als Mittel zur grundlegenden Veränderung politischer Verhältnisse eher skeptisch gegenüber; Tarek sieht den Rechtsweg als ein noch weitgehend unterschätztes Mittel im politischen Kampf um mehr Gleichheit und Freiheit.
Diese Differenzen in den Perspektiven hängen u. a. damit zusammen zusammen, dass wir in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Fanny vertritt meist Menschen, die in Not sind; regelmässig geht es darum, ob sie in der Schweiz bleiben dürfen oder gehen müssen. Sie muss binnen knapper Frist und im Rahmen einer restriktiven Praxis des Migrationsrechts für einen Mandanten oder eine Mandantin das Beste vor Gericht herausholen. Der politische Spielraum bleibt eng, auch wenn fast jeder Fall politische Bedeutung hat. Anders engagiert sich Tarek mithilfe von Menschen, die in gesicherten Aufenthalts- und Einkommensverhältnissen leben und ihre Privilegien dafür einsetzen, den Rechtsstaat mit rechtlichen Mitteln unter Druck zu setzen, damit er Recht umsetzt und gewährt. Dabei geht es um einen grundlegenden Wandel im Bürgerrecht und gegen Diskriminierung, insbesondere um die Mobilisierung von Widerstand gegen strukturellen Rassismus bei Teilen von Polizei und Justiz.
Während die geteilten Werte uns im Lauf der Zeit immer wieder zusammenbrachten, um uns über die emanzipatorischen Potenziale des Rechts auszutauschen, machten die unterschiedlichen Erfahrungen unsere Gespräche ambivalent und kontrovers. So haben wir uns schliesslich Zeit genommen, den Dialog in eine Form zu giessen: Suchend entwickelten sich unsere Gedanken mit einem ersten Brainstorming, danach schrieben wir manchmal für uns allein, andere Male telefonierten oder reflektierten wir gemeinsam. Das hier ist das Ergebnis: ein kritisch-fragender Debattenbeitrag über die Bedeutung des Rechts im Kampf um Teilhabe.
Kämpfe um das Bürger:innenrecht - zwischen Ausgrenzung und Emanzipation
TAREK NAGUIB: Mein Vater, der in Kairo aufgewachsen ist, liess sich 1970 auf dem Höhepunkt der Überfremdungsdebatte in der Schweiz nieder. Trotz positiver Voraussetzungen als promovierter Ingenieur hatte er bis zu seiner Einbürgerung 1980 Angst, das Land verlassen zu müssen. Diese Erfahrung war auch der Grund, weshalb sich mein Vater mit mir immer wieder über die Ungerechtigkeiten unterhielt, die vor allem die sogenannt niedrig qualifizierten Gastarbeiter damals erfahren mussten. Ich erinnere mich noch an eine Szene, als wir in den 1980er-Jahren gemeinsam die Tagesschau sahen, in der über die «Mitenand-Initiative» berichtet wurde, eine zivilgesellschaftliche Bewegung für die Rechte der Migrant:innen. Erst Jahre später wurde mir bewusst, welch gespaltenes Verhältnis die sozialen Bewegungen damals gegenüber dem Rechtsstaat und dem Rechtssystem hatten. Auf der einen Seite kämpften sie um fundamentale Grund- und Menschenrechte wie etwa das Recht auf Familiennachzug, Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt, soziale Sicherheit und eine diskriminierungsfreie Einbürgerungspraxis. Auf der anderen Seite gab es eine große Skepsis gegenüber dem Gesetzgeber, den Gerichten und den Verwaltungsbehörden. Irgendwie paradox.
FANNY DE WECK: Es ist normal, denke ich, dass Minderheiten und rechtlich Benachteiligte oft ein ambivalentes Verhältnis zu Gesetz und Justiz haben. Wer nicht vollwertiges Mitglied der Rechtsgemeinschaft ist, in der er oder sie lebt, will einerseits am etablierten Rechtssystem gleichwertig teilnehmen können und fordert das ein; andererseits besteht natürlich eine grundlegende Skepsis gegenüber einem System und seinen Institutionen, von dem man als Person massiv abhängt, das einen aber nicht als gleichberechtigt anerkennt. Wobei erwähnt sei, dass die juristischen Möglichkeiten in Sachen Grundrechte und Minderheitenschutz früher noch beschränkter waren als heute. So hat die Eidgenossenschaft die Europäische Menschenrechtskonvention erst 1974 ratifiziert. Die Gleichstellung der Geschlechter kam erst 1981 in die Bundesverfassung und das Diskriminierungsverbot explizit erst mit der Totalrevision im Jahr 1999. Überdies sind leider der Zugang zur Justiz und der Rechtsschutz – bis heute – allzu oft eine Frage der finanziellen Mittel und – nicht zu vernachlässigen – des Wissens um diese Möglichkeit.
Die Skepsis der Betroffenen gegenüber der Justiz ist aber auch deshalb nachvollziehbar, weil Gerichte gerade in der Schweiz meines Erachtens oftmals noch konservativer sind als die Gesetzgebung, also das Parlament und die Stimmbevölkerung. Genauer gesagt, die Justiz hinkt sowohl regressiven als auch progressiven Tendenzen im politischen Diskurs immer etwas hinterher. Obwohl das Recht im Bereich Grundrechte und Minderheitenschutz heute mehr Möglichkeiten bietet als früher, gilt also nach wie vor: Neben dem nötigen Geld braucht es viel Mut und Unterstützung, um den Rechtsweg zu gehen und vor Gericht eine strukturelle Ungerechtigkeit zu bekämpfen: so wie dies 1990 die Frauenrechtsaktivistin Theresia Rohner tat, als sie bis vor Bundesgericht für das Frauenstimmrecht in Appenzell Innerrhoden kämpfte. Frau Rohner wurde auf übelste Weise beschimpft und bedroht.
Zum Fall von Theresia Rohner (Bundesgerichtsurteil vom 27.11.1990, BGE 116 Ia 359)
Im Jahr 1990 wandte sich Theresia Rohner mit zahlreichen weiteren Frauen und Männern aus Appenzell Innerrhoden an das Bundesgericht; sie rügten, dass die fehlende Stimmberechtigung der Frauen in ihrem Kanton verfassungswidrig ist. Das Bundesgericht gab ihr per Urteil vom 27. November 1990 Recht. Es stütze sich dabei auf den 1981 in der Bundesverfassung verankerten Artikel zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Appenzell Innerrhoden führte daraufhin als letzter Kanton der Eidgenossenschaft das Stimmrecht für Frauen auf kantonaler Ebene ein. Noch im April 1990 hatte sich eine Mehrheit der Männer in Appenzell Innerrhoden in einer Volksabstimmung gegen die Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene entschieden.
TAREK NAGUIB: Der Fall «Rohner» ist ein typisches Beispiel dafür, dass zwischen Recht haben und Recht bekommen ein weiter Weg liegen kann. Gerade Menschen, die schwerwiegenden Benachteiligungen ausgesetzt sind, müssen immense Kräfte gegen teils grosse Widerstände mobilisieren, wenn sie sich auf dem rechtlichen Weg gegen Unrecht wehren wollen.
FANNY DE WECK: Genau. Es bedurfte des Kraftakts einer jahrelangen politischen Auseinandersetzung und des unermüdlichen Einsatzes vieler Frauen und Männer für Gleichberechtigung, bis es zu einem Rechtsfall wie Rohner gegen Appenzell Innerrhoden kommen konnte – und der Fall obendrein gewonnen wurde. Aus dem luftleeren Raum heraus werden wichtige Gerichtsentscheide mit politischer Dimension kaum gewonnen. So schwer wir uns das aus heutiger Sicht vorstellen können – die Richter in Lausanne hätten damals juristisch auch durchaus zum Schluss kommen können, die Beschwerde von Frau Rohner sei unter Hinweis auf den Föderalismus bzw. die Kantonsautonomie abzuweisen. Es bedurfte eines politischen Rücken- winds für das Urteil, und der wehte Anfang 1990er-Jahre heftig. So gesehen kann man das Bundesgericht zu jenem Zeitpunkt und vor diesem Hintergrund auch nicht als sonderlich mutig bezeichnen.
TAREK NAGUIB: Wie meinst du das?
FANNY DE WECK: Die Schweiz war schon 1971 bei Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts auf eidgenössischer Ebene eine Nachzüglerin in Europa. Das Bundesgericht muss Anfang der 1990er-Jahre einen starken öffentlichen Druck gespürt haben, den unmöglichen Zustand, der auf kantonaler Ebene andauerte, endlich zu beenden. Das ist die beste Ausgangslage, um einen wichtigen Rechtsfall zu gewinnen. Frau Rohner war zudem im Beschwerdeverfahren nicht allein, sondern hat dieses mit zahlreichen Mitstreiter:innen aus Appenzell Innerrhoden eingeleitet. Das soll die Bedeutung ihres Einsatzes und des Urteils nicht schmälern; es zeigt einfach, dass wichtige Urteile oftmals eher das Ergebnis eines lange vorangegangenen politischen Kampfs sind, statt dass sie diesen Kampf begründen. Anders gesagt, beim Erstreiten von Rechten und Emanzipation sind Gerichtsurteile mit Breitenwirkung in der Regel eher Wirkung als Ursache.
Das Migrationsrecht als umkämpftes Feld
TAREK NAGUIB: Was können wir aus dem Fall «Rohner» mit Blick auf die Rechte von Menschen mit Migrationsgeschichte lernen?
FANNY DE WECK: Im Bereich des Migrationsrechts ist die aktuelle Ausgangslage eine ganz andere als Anfang der 1990er-Jahre, als es um das kantonale Frauenstimmrecht ging. So gibt es derzeit zu wenig öffentlichen Druck auf Gerichte und Institutionen, dass diese dazu beitragen sollen, die Rechte von Personen ohne Schweizer Pass zu erweitern: weder im klassischen Ausländerrecht, wo die Bedingungen insbesondere für ärmere ausländische Personen im Gegenteil jüngst verschärft wurden, noch im Asylrecht.
Im Gegenteil profilieren sich sogar einzelne Sozialdemokraten mit einer unnötig harten Linie im Migrationsbereich, etwa Regierungsrat Mario Fehr im Kanton Zürich. So müssen armutsbetroffene Personen ohne roten Pass bei Sozialhilfebezug im Kanton Zürich systematisch migrationsrechtliche Sanktionen bis hin zu einer Wegweisung befürchten, selbst wenn sie Anspruch auf den Sozialhilfebezug haben. Gerade seit der Covid-19-Pandemie ist dies für viele Menschen aus dem Niedriglohnsektor und ihre Familien fatal. Grundsätzlich stehen die Grundrechte im Bereich Migration massiv unter Druck: nicht nur auf nationaler, leider auch auf internationaler Ebene. Auch in Strassburg, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, bläst inzwischen ein härterer Wind. Bestimmte wichtige Urteile aus den 1990er- oder 2000er-Jahren würden die Strassburger Richter:innen heute nicht mehr so fällen.
TAREK NAGUIB: Gibt es ein aktuelles Beispiel?
FANNY DE WECK: Erst kürzlich traf der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrere Entscheide zur Wegweisung von Personen, die seit Jahren in der Schweiz leben oder gar hier geboren worden sind. Dabei hat der Gerichtshof eine äusserst formalistische und harte Linie gefahren, was einzelne Richter in Minderheitsmeinungen kritisiert haben. In einem Fall hat er sogar die Wegweisung eines Secondos gedeckt, der sich klassischer Jugenddelikte strafbar gemacht und danach über viele Jahre bewährt hatte. Der Gerichtshof ignorierte in diesem Entscheid schlichtweg seine eigene Rechtsprechung zu Jugendkriminalität und Secondos, die bisher eine solche Wegweisung eigentlich nur beim Vorliegen schwerwiegender Gründe zulässt. Diese Entwicklung beobachte ich mit Sorge.
TAREK NAGUIB: An diesem Beispiel zeigt sich ja auch, wie eng das Mehrklassensystem im Ausländerrecht mit dem Bürgerrecht und dem rechtlichen Schutz vor Diskriminierung verknüpft ist. Wer keinen Schweizer Pass hat oder wem aufgrund der Herkunft seiner Eltern oder Grosseltern auf diskriminierende Weise die Einbürgerung verweigert wird, obwohl er oder sie hier geboren ist, riskiert aufgrund von Armut oder Jugendsünden aus dem eigenen Land verwiesen zu werden.
FANNY DE WECK: Dem ist so. Vielen ist nicht bewusst, dass die Eidgenossenschaft Personen aus der Schweiz verweist, die hier geboren wurden und aufgewachsen sind. Dies war bereits vor Annahme der Ausschaffungsinitiative im Jahr 2010 möglich, doch die Situation hat sich verschärft. So sieht das Strafgesetz seit Umsetzung der Ausschaffungsinitiative im Jahr 2016 einen sehr breiten Katalog von Delikten vor, bei deren Vorliegen der Strafrichter/die Strafrichterin grundsätzlich eine Landesverweisung anzuordnen hat – selbst wenn die Person für diese Taten nicht einmal eine Haftstrafe absitzen muss oder der Richter oder die Richterin anerkennt, dass das Verschulden bei der Tat gering war. In Kombination mit den hierzulande ausserordentlich hohen Hürden für den Erwerb des Bürgerrechts schafft das unhaltbare Situationen. So werden Personen aus der Schweiz verwiesen, die zum Herkunftsland ihrer Eltern oder Grosseltern praktisch keine Beziehung haben, manchmal nicht einmal die Sprache sprechen. Das ist ein Skandal. Zwar hat es der Ständerat bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative mit der sogenannten «Härtefallklausel» doch noch geschafft, dass der Strafrichter im Einzelfall von einer Landesverweisung absehen kann. Diese Ausnahmeklausel wird jedoch restriktiv und von Kanton zu Kanton unterschiedlich angewendet. Für die Betroffenen und ihre Familien (darunter Schweizer Ehepartner und Kinder) bedeutet die Landesverweisung eine Doppelbestrafung. Gerade beim Bundesgericht scheint man für ihre Interessen aus politischen Gründen aber wenig Gehör zu haben. Hier darf man gerade bei höheren Instanzen vorderhand wenig darauf bauen, vor nationalen Gerichten Erfolge zu erzielen, auch wenn wir es als Anwält:innen trotzdem versuchen – versuchen müssen. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg auf seine ursprüngliche Rechtsprechung zurückkommen wird und die Wegweisung von Personen, die hier geboren und aufgewachsen sind, nur dann akzeptiert, wenn besonders schwerwiegende Gründe vorliegen.
TAREK NAGUIB: Ist das nicht frustrierend, wenn mit dem Rechtsweg kaum etwas bewegt werden kann, egal ob im Korsett des nationalstaatlichen Rechts oder im Rahmen der international geschützten Menschenrechte? Ich frage mich, woher du die Energie nimmst, dich als Anwältin einzusetzen, wenn du zunehmend an eine Mauer aus rechtsstaatlicher Ignoranz läufst. Das geht doch nur, wenn es auch Fortschritt gibt oder aber sich grundlegend was ändert.
Ich selbst mache auch Erfahrungen, die mich ermutigen, wenn auch nicht im Bereich des klassischen Ausländerrechts, sondern des Bürgerrechts. So kam es 2003 für mich überraschend zu einem bahnbrechenden Urteil des Bundesgerichts, dem sogenannten «Emmen-Urteil». Das Bundesgericht hatte damals über insgesamt 23 Einbürgerungsgesuche zu entscheiden, wobei sämtliche Gesuchsteller:innen aus Italien eingebürgert wurden. Dagegen wurde allen anderen, die in der überwiegenden Mehrheit aus dem ehemaligen Jugoslawien stammten, die Einbürgerung ohne objektive Gründe verweigert. Das Bundesgericht hatte hier eine Diskriminierung festgestellt. Zudem hat es damals die Einbürgerung an der Urne als rechtswidrig erklärt, weil ein «Nein» auf einem Abstimmungszettel nicht begründet werden kann. Dies brachte weite Teile des Einbürgerungsrechts ins Wanken. Aufgrund des Urteils stellten zahlreiche Gemeinden ihre Einbürgerungsverfahren an der Urne auf weniger diskriminierungsanfällige Verwaltungsverfahren um. Eine hochwirksame Errungenschaft zugunsten der Rechte der migrantischen Bevölkerung, auch wenn immer noch viele Gemeinden Einbürgerungen an der Gemeindeversammlung vornehmen lassen. Auch dies müsste man längst einmal mit einem Rechtsverfahren angreifen.
FANNY DE WECK: Der Fall Emmen ist von Bedeutung und ein gutes Beispiel für emanzipatorische Rechtspraxis. Gerne komme ich darauf zurück. Zunächst will ich präzisieren, dass es in der alltäglichen Anwaltsarbeit zum Migrationsrecht nun wirklich nicht immer so düster ist. Ich gehe so weit, zu behaupten, dass man im klassischen Ausländerrecht, verglichen mit anderen Rechtsgebieten, verhältnis- mässig oft vor Gericht gewinnt, sofern man die Arbeit ernst nimmt. Denn die Migrationsbehörden agieren regelmässig willkürlich – und zwar mit einer Willkür, die in anderen Rechtsgebieten undenkbar wäre. Deshalb können wir immer wieder korrigierende Urteile von Gerichten erstreiten. Das ist für die Betroffenen eine grosse Erleichterung und für uns Anwältinnen ermutigend. Frustrierend ist einfach, dass nur diejenigen zu ihrem Recht kommen, die sich rechtliche Hilfe holen und leisten können; und dass selbst die Urteile höchster Instanzen viel zu oft wenig bis keinen Effekt auf die Praxis und Kultur der Migrationsbehörden haben.
Ich denke, die von dir genannten Urteile zum Bürgerrecht um die Jahrtausendwende sind eher eine Ausnahme; sie waren jedoch tatsächlich von grosser Breitenwirkung. Heute scheint es uns evident, dass man in einem Einbürgerungsverfahren minimale Verfahrensrechte hat und nicht diskriminiert werden darf. Lang war das alles andere als selbstverständlich, da die Einbürgerung als rein politischer und nicht auch als rechtlicher Akt betrachtet wurde. Die Rechtsprechung hat tatsächlich grundlegende Weichen für eine fairere Einbürgerungspolitik gestellt. Allerdings ist die Realität in Sachen Bürgerrecht in der Schweiz immer noch bitter. So bleiben, im europaweiten Vergleich, die Voraussetzungen für eine Einbürgerung aussergewöhnlich hoch. Und die Verfahren lassen nach wie vor viel Raum für Willkür. Erst vor kurzem vertrat ich eine Person, die seit über zwanzig Jahren hier lebt und deren Einbürgerungsgesuch von der Gemeinde Schlieren abgelehnt worden war: weil die Person etwa die Prüfungsfrage nicht beantworten konnte, in welchem Jahr Schlieren zum ersten Mal schriftlich Erwähnung fand (es handelt sich um das Jahr 828 n. Chr.). Erst vor dem Zürcher Verwaltungsgericht haben wir wegen der Willkür und des überspitzten Formalismus gewonnen. Allerdings werden sich die wenigsten Menschen in Einbürgerungsverfahren einen Anwalt nehmen und leisten können.
TAREK NAGUIB: Ich bin mit dir einverstanden, dass im Schweizer Bürgerrecht das meiste noch im Argen liegt. Du hast die restriktive Praxis, die Hürden beim Zugang zum Rechtsschutz und die Kosten ja bereits genannt. Hinzu kommt das fehlende Rechtsbewusstsein, das viele daran hindert, den Rechtsweg überhaupt ins Auge zu fassen, oder sie auf der Strecke entmutigt. Ebenfalls Teil des Problems sind die lange Dauer und die für Laien komplizierten sowie autoritär erscheinenden und teuren Rechtsverfahren, die Unsicherheiten und Stress auslösen und den Rechtsweg äusserst unattraktiv machen. Wer es wagt, sich gegen die Verweigerung der Einbürgerung zu wehren, riskiert insbesondere in kleinen Gemeinden, sich zu exponieren. Nicht selten kommt es zu rassistischen Anfeindungen aus der Bevölkerung, ja gar zu gewalttätigen Übergriffen, wie dies etwa Benon P. in einer St. Galler Gemeinde erfahren musste. Unser Rechtssystem ist mit seiner widersprüchlichen und wenig versöhnlichen Logik nicht darauf ausgelegt, dass Minderheiten in ihren Rechten effektiv geschützt werden, sondern dass sie Rechtsbrüche des Staates widerstandslos hinnehmen.
Zum Fall von Benon P. (Bundesgerichtsurteil vom 12.06.2012, BGE 138 I 305)
Das Bundesgericht hat 2012 entschieden, dass die Gemeinde Oberriet, die Benon P. an der Gemeindeversammlung die Einbürgerung verweigerte, rechtskonform handelte. Dies obwohl es im Vorfeld, während und im Nachgang der Gemeindeversammlungen mehrfach zu offen rassistischen Aussagen von Seiten der Stimmbürger:innen kam. So etwa, dass Menschen aus der Balkanregion suspekt und kriminell seien. Auch wurde Benon P. negativ angerechnet, dass er sich aus dem Behindertensport verabschiedet hatte, nachdem er dort immer wieder auf diskriminierende Weise zurechtgewiesen wurde. In einem Votum sagte eine Stimmbürgerin, sie wolle nicht, dass hier bald eine Moschee stehe. Zudem wurde ihm vorgeworfen, er wolle sich nur einbürgern lassen, um sich am Sozialstaat zu bereichern. Benon P. gelangte insgesamt drei Mal vor die Bürgerversammlung, ihm wurde dabei von verschiedener Seite Zwängerei vorgehalten.
TAREK NAGUIB: Diese grossen Probleme dürfen unseren Blick auf die politischen Potenziale aber nicht verstellen. Hierfür müssen wir nur die Perspektive wechseln, weg von den vielen verlorenen Einzelfällen, hin zu strukturellen Fragen. Ich meine das nicht zynisch, im Gegenteil: Ich bin der Auffassung, dass klug gewählte Fälle und orchestrierte Rechtsverfahren dazu dienen können, Justiz und Verwaltung aufzurütteln sowie Zivilgesellschaft und Politik zu mobilisieren. Und dass sie dadurch Spielräume für politische Veränderungen zum Besseren schaffen. So wurde unter anderem dank dem Emmen-Urteil das Bürgerrecht in den 2000er-Jahren zum umkämpften Feld. Einerseits bildete das Urteil die Grundlage für viele Beschwerden gegen diskriminierende und anderweitig willkürliche Einbürgerungsverweigerungen. Andererseits wurde von rechtspopulistischer Seite am 18. November 2005 die Verfassungsinitiative «für demokratische Einbürgerungen» lanciert, mit der das Emmen-Urteil rückgängig gemacht werden sollte. Die rassistische Abstimmungskampagne, die sich damals besonders heftig gegen Muslim:innen richtete, wurde am 1. Juni 2008 mit 63,8 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Ich vermute, dass dabei die zwei Wochen davor statt gefundene Abstimmungsarena (wöchentliche Politsendung im Schweizer Fernsehen), bei aller Kritik an diesem Format, eine wichtige Rolle spielte in der Mehrheitsbeschaffung. Schweizer:innen, die Nein sagen, würden ihr Nein begründen, sagte die damals zuständige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf in der Sendung. Diese rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit wurde so erst zur politisch legitimierten Norm. Ohne Urteile des Bundesgerichts wäre es kaum zu dieser durch eine sogenannte Volksmehrheit gestützten Abschaffung der Einbürgerung an der Urne gekommen.
FANNY DE WECK: Das stimmt, in Sachen Einbürgerung hat die Rechtsprechung tatsächlich elementare Weichen gestellt und der Willkür gewisse Grenzen gesetzt. Der Spielraum der Gemeinden beim Erteilen des Bürgerrechts – der noch immer allzu oft für unsachliche und diskriminierende Nichteinbürgerungen strapaziert wird – ist kleiner geworden. Allerdings wurde das Schweizer Bürgerrecht mit der neusten, 2018 in Kraft getretenen Revision in der Summe wieder verschärft. So kann sich nur noch einbürgern lassen, wer eine Niederlassungsbewilligung hat – womit bestimmte Personen, insbesondere vorläufig Aufgenommene, über Jahre hinweg von der Einbürgerung ausgeschlossen sind. Auch die Kriterien zur geforderten Integration wurden verschärft, sodass ein einmaliger Sozialhilfebezug oder ein Bagatelldelikt den Weg zum roten Pass auf Jahre hinaus versperren kann. Die Anzahl an Einbürgerungen hat denn seit Inkrafttreten der Totalrevision deutlich abgenommen. Manchmal schaffen die Gerichte also neue Spielräume, und die Gesetzgebung engt sie an anderer Stelle wieder ein, oder umgekehrt. Will man politisch nachhaltig agieren, muss man beide im Blick haben.
Strategische Politisierung durch den Rechtsweg
TAREK NAGUIB: Du bist hinsichtlich des befreienden Potenzials des Rechtsweges für Minderheiten skeptisch. Ich verstehe das. Ich möchte hier aber doch nochmals was zur Verteidigung des Rechtskampfes anbringen, unabhängig von seinen scheinbaren Erfolgen oder Misserfolgen. Der deutsche Sozialwissenschaftler Aladin El-Mafaalani sagt in seinem Buch «Das Integrationsparadox», dass Konflikte ein Zeichen für das Zusammenwachsen von Gesellschaften und mehr Gerechtigkeit sind, da ehemalige Minderheiten nun auch mitreden wollen, anstatt nur stumm zu ertragen. Je mehr wir um Gerechtigkeit in der postmigrantischen Gesellschaft ringen, desto mehr wird es zu rassistischen Abwehrreaktionen kommen, auch im Rechtssystem. Je stärker dieser Ausgrenzung mit dem Recht widersprochen wird, desto grösser sind die Chancen, die eigene widerständische Position als Teil des Rechtssystems zu stärken. Und ich verstehe das hier nicht als Tatsachenfeststellung, sondern als Appell: Auch Rechtskämpfe, die auf den ersten Blick keine Aussicht auf Erfolg haben, müssen geführt werden. Denn Befreiung gibt es nur, wenn auch darum gerungen wird und wenn die normative Kraft des Faktischen gezielt eingesetzt wird.
FANNY DE WECK: Da stimme ich dir zu – glaub mir, in der Praxis führen wir regelmässig solche Rechtskämpfe. Und natürlich sehe ich weitergehen- des Potenzial im Rechtsstreit, sonst könnte ich meine Arbeit kaum machen. Der Rechtsstreit führt meines Erachtens jedoch selten zur nachhaltigen Beseitigung eines unhaltbaren politischen Zustands. Mit anderen Worten ist ein politisch erkämpftes Recht in der Regel nachhaltiger als ein juristisch errungenes. Selbstverständlich kann der Rechtsstreit für die Debatte und die Sensibilisierung wichtig sein, zumal wenn genügend Mittel und Kräfte für die politische und mediale Einbettung dieses Rechtsstreits vorliegen, was selten der Fall ist. Dabei dürfen sich Jurist:innen von kurz- oder mittelfristigen Rückschlägen nicht abschrecken lassen.
TAREK NAGUIB: Genau. Darum ist es ja auch wichtig, dass wir sogenannte strategische Rechtsverfahren anstreben. Dabei handelt es sich um Rechtsverfahren, die gerade nicht primär dem Schutz einer rechtsuchenden Person dienen, sondern auch den Zweck haben, grundlegende Veränderungen in Gesellschaft, Politik oder im Rechtssystem anzustossen. Ein beispielhafter strategischer Prozess ist der Fall Wilson A., der im Rahmen einer rassistisch initiierten und unverhältnismässig verlaufenen Polizeikontrolle 2009 beinahe ums Leben kam. Er kämpfte über acht Jahre lang mit seinem Anwalt und mit Unterstützung der Familie darum, dass die Polizisten sich vor Gericht verantworten müssen. Die zuständige Staatsanwältin hatte bis ins Jahr 2017 alles darangesetzt, das Verfahren ohne unabhängige Untersuchung einzustellen. Auch dank dem Druck der Allianz gegen Racial Profiling, die im Dezember 2016 auf das Verfahren aufmerksam wurde, kam es zur Wende: Der Zusammenschluss von Forscher:innen, Aktivist:innen und Menschenrechtsorganisationen kritisierte das Verfahren in den Medien als institutionell rassistisch. Zudem organisierte die Allianz vor Gericht Kundgebungen und setzte ein Team aus Wissenschaftler:innen zusammen, die den Prozess beobachteten und analysierten. Aufgrund dieser Aufmerksamkeit kam der zuständige Vorsitzende des erstinstanzlichen Bezirksgerichts zum Schluss, dass das Verfahren vor einem Gremium aus drei Richtern und nicht nur mit einem verhandelt werden müsse. Bemerkenswert ist seine Begründung, die darin bestand, dass «Polizisten angeklagt sind», «der Privatkläger eine schwarze Hautfarbe hat» und das Interesse der Öffentlichkeit an einer richterlichen Beurteilung und an der Ermittlung der historischen Wahrheit sowie das Interesse an einem fairen Verfahren besonders hoch zu gewichten seien. Letztlich gehe es um die Glaubwürdigkeit der Justiz.
Die Fälle Wilson A. und Mohamed Wa Baile
Wilson A. wurde im Jahr zum Opfer rassistischer Polizeigewalt. Am 18. April 2018 kam es vor Bezirksgericht Zürich zum Freispruch der drei Polizeibeamt:innen. Das Urteil wurde von vielen Kommentator:innen kritisiert, weil die Staatsanwaltschaft das Verfahren zwei Mal einstellen wollte, ohne der Sachlage auf den Grund zu gehen. Der Rechtsanwalt von Wilson A. legte Berufung gegen das Urteil ein. Trotz mehrmaliger Anträge haben sich alle Instanzen geweigert, den Vorfall durch ein unabhängiges Gutachten untersuchen zu lassen. Der Fall droht aufgrund der jahrelangen Verschleppung noch bevor er vor das Bundesgericht gelangt, zu verjähren.
Ein weiterer beispielhafter strategischer Prozess ist der Fall von Mohamed Wa Baile, der sich gegen den Rassismus von Polizei und Justiz zur Wehr setzt, und schon bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelangt ist. Mohamed Wa Baile hatte sich im Februar 2015 im Rahmen einer polizeilichen Personenkontrolle am Zürcher Hauptbahnhof geweigert, sich auszuweisen, weil er die Kontrolle als rassistisch empfand. Am 7. März 2018 bestätigte das Bundesgericht die Verurteilung von Wa Baile wegen Nichtbefolgens polizeilicher Anweisung durch das Zürcher Obergericht. Die Vorinstanz habe ihr Urteil hinreichend begründet, eine willkürliche Beweiswürdigung sei nicht gegeben. Parallel zum strafrechtlichen Verfahren hat Wa Baile ein verwaltungsrechtliches Feststellungsbegehren eingereicht. Das Zürcher Verwaltungsgericht entschied am 1. Oktober 2020, dass die Kontrolle Wa Bailes am Hauptbahnhof Zürich rechtswidrig war. Offen liessen die Richter:innen hingegen, ob es sich dabei auch um eine Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe gehandelt hat. Auch hier stützt das Bundesgericht in einem Urteil von Ende 2020 das polizeiliche Handeln. Beide Verfahren wurden von Mohamed Wa Baile mit Unterstützung der Allianz gegen Racial Profiling an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergezogen und werden derzeit überprüft.
FANNY DE WECK: Ich sehe, dass es in diesen Fällen darum geht, Rassismus zu thematisieren, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und eine Bewegung zu stärken. Es geht nicht bloss ums Gewinnen, sondern darum, eine Diskussion zu befördern und Kräfte zu bündeln.
TAREK NAGUIB: Genau, es geht darum, sichtbar zu machen, dass innerhalb der Polizeiführung, der Justiz und der Politik, Rassismus und Polizeigewalt verharmlost, ja gar gedeckt werden. Es geht darum, die Gesellschaft als Ganze aufzurütteln und aufzufordern, hinzuschauen und Widerstand zu leisten. Rund um das Verfahren haben sich zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen wie etwa die Allianz gegen Racial Profiling gebildet, es wurden Studien verfasst, Workshops durchgeführt, Tribunale inszeniert, Filme produziert und Medienschaffende dazu inspiriert, sich dem Thema des strukturellen Rassismus und seinen Auswirkungen auf den Rechtsstaat zu widmen.
FANNY DE WECK: Die sogenannte strategic litigation ist aktuell bei Menschenrechtsaktivist:innen in aller Munde. Auch wir in unserer Kanzlei führen Prozesse, die man einer solchen strategischen Prozessführung zuordnen kann. Das Mittel ist in bestimmten Konstellationen sicher sinnvoll, so wie in den von dir geschilderten Fällen, aber auch im Bereich des Umweltrechts oder der Verantwortung von Konzernen etwa. Ich überschätze die Wirkmacht des Ansatzes somit nicht. In der Praxis ist eine strategische Prozessführung komplexer, als man sich das zuweilen an Universitäten oder in NGOs vorstellen mag. Als Rechtsanwältin bin ich verpflichtet, stets die Interessen der betroffenen Person zu vertreten, die nicht unbedingt politisch sind. Wir Anwält:innen sind jeden Tag mit Personen konfrontiert, die unter einem ganz handfesten Problem leiden und sehr beschränkte Mittel haben; mit unserer Arbeit wollen, müssen und können wir Abhilfe schaffen. Ferner sind Rechtsstreitigkeiten für die Betroffenen äusserst belastend, besonders wenn es sich um vulnerable Personen aus prekären Verhältnissen handelt. Mit anderen Worten ist der Rechtsstreit in der Regel eine Qual und keine Wahl. Es ist dann nur verständlich, wenn diese Personen keine Lust auf Öffentlichkeit haben. Und wie heisst es so schön: «Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.» So gesehen ist es schwierig, als Prozessierende:r die Richtung eines Falls oder die Bedeutung eines Urteils zu steuern, um unmittelbar vor Gericht den politischen Kampf zu führen. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Voraussetzung sind überaus motivierte Beteiligte, die bereit sind, hohe Risiken auf sich zu nehmen. Wer den Rechtsstreit als politisches Mittel feiert, muss all das mitbedenken.
TAREK NAGUIB: Grundsätzlich geht es hier um eine langfristige gesellschaftliche Perspektive. Mohamed Wa Baile selbst beschreibt, dass ihn sein Rechtsverfahren und die damit verbundene Widerstandspraxis persönlich und politisch gestärkt haben. Dem Rechtsstaat gemeinsam zu widersprechen ist eine Form der kollektiven Ermächtigung, die Kräfte und Kreativität freisetzt. Zudem werden mächtige institutionelle Routinen destabilisiert, denn die Menschen an den jeweiligen institutionellen Machthebeln können je länger je weniger damit rechnen, dass ihr Handeln widerspruchsfrei hingenommen wird. Zudem führt dies auch zu einer kollektiven Ermächtigung, die durch das «Charisma» des Rechtskampfes ausgelöst werden kann. Oder vielleicht ist es zutreffender von symbolischer Attraktivität des Rechtskampfes zu sprechen, einer Art juridischen Aura des kollektiven Widerstandes. Die zivilgesellschaftliche Mobilisierung hat Tausende von Menschen darin gestärkt, sich auch im Alltag gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Entrechtung zu wehren.


TAREK NAGUIB: Ich behaupte auch, dass diese Arbeit über nun mehr als fünf Jahre mit dazu beigetragen hat, dass die antirassistischen Kundgebungen letzten Sommer auf einen Nährboden gefallen sind, der unter anderem durch solche Prozesse geschaffen wurde. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die betroffenen Kläger:innen, die sich hier weit aus dem Fenster lehnen, Unterstützung haben und wenn möglich nicht in rechtlich und finanziell prekären Verhältnissen leben.
FANNY DE WECK: Genau. Insofern sehe ich den Fall Mohamed Wa Baile mit seiner Einbettung in eine Bewegung als best practice der strategischen Prozessführung in der Schweiz. Nur im Zusammenspiel mit hochmotivierten Personen und dank starker Unterstützung von Organisationen ist es möglich und vertretbar, bewusst strategische Prozesse anzustreben. Damit verneine ich keineswegs deren Bedeutung und schmälere ich schon gar nicht das Engagement der Betroffenen, für die ein solcher Prozess sowohl bestärkend als auch belastend sein kann. Aber das Beispiel verdeutlicht, dass das Recht als politisches Mittel kein Alltagsinstrument ist. Trotzdem gehe ich mit dir einig, dass ein strategisch geführtes Verfahren Teil eines politischen Kampfs sein kann, wie du anhand des Falls Wa Baile eindrücklich aufzeigst.
Ein weiteres Beispiel ist der Verein der KlimaSeniorinnen. Unter Verweis auf das Recht auf Leben sind sie bis vor das Bundesgericht gegangen, um vom Schweizer Staat mehr Klimaschutzmassnahmen zu fordern. Auch sie haben aktuell eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig. Im Fokus steht bei solchen Prozessen dann aber die Justiz als Mittel, nicht als Lösung. Es geht dann auch um Community Building und um mediale Aufmerksamkeit, was für den politischen Kampf wertvoll sein kann. Was aber die Rechtsprechung betrifft, sollte die Wirkung des Rechtsstreits nicht überschätzt werden. So sind Gerichte in der Regel eher konservativ: Ich kenne im Positiven wie im Negativen keine «Revolutionen», die über die Justiz gemacht wurden. Und trotz Gewaltenteilung: Meines Erachtens sind politische Akteur:innen an der «Formbarkeit» der Justiz stärker interessiert als umgekehrt der Justizapparat daran, die Politik zu formen. Überdies formen die politischen Machtträger erfolgreicher. Es sind regelmässig Minderheiten und Gruppen mit beschränkter politischer Macht und ohne mediale Unterstützung, die dies dann zu spüren bekommen.
TAREK NAGUIB: Dass die Menschen und Grundrechte im Ausländer-, Asyl- und Bürgerrecht – aber nicht nur dort – zunehmend in Frage gestellt werden, ist auch Folge eines grundsätzlichen Problems moderner Nationalstaaten: Moderne Nationalstaaten wie die Schweiz tragen ebenso das Erbe des kolonialen Mythos der «Überlegenheit westlicher Nationen» in sich, welcher dazu führte, dass der Zugriff auf Menschen, die als «Fremde» gelten, sowie willkürliche Eingriffe in ihre Rechte, als normal gelten. Eine Gesellschaft, deren Geschichte massgeblich auf rassistischen Ideologien in Religion, Wissenschaft und Alltagskultur beruht und die darauf ausgerichtet ist, das Streben der «eigenen Nation» nach Sicherheit, Wohlstand und Identität abzusichern, bringt quasi «zwangsläufig» eine Migrations- und Sicherheitspolitik hervor, die Menschen unterschiedlicher Klassen und Rechte schafft. Kurz, unser Rechtssystem ist auch Teil der Herrschaftsverhältnisse, die den Status der Schweiz – das heisst ihrer Eliten, resp. Mittelschichten – als koloniale und postkoloniale Gewinnerin absichern.
FANNY DE WECK: Klar ist, dass das Konzept des Nationalstaats überhaupt erst die Existenz eines Migrationsrechts ermöglicht, das den Menschen unterschiedliche Rechte verleiht, obwohl sie auf demselben Territorium leben. Dies ist unter dem Prinzip, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (vgl. Art. 8 der Bundesverfassung), problematisch. Besonders stossend ist die Ungleichbehandlung, so- bald es um Personen geht, die seit eh und je in der Schweiz leben oder sogar hier geboren worden sind. Hier widerspiegelt das Migrationsrecht im Grunde die Eigenart eines «kleinen Herrenvolks», um es in Max Frischs Worte zu fassen. Vor diesem Hintergrund stellt sich im Bereich Migrationsrecht die unbequeme Frage, ob man als Rechtsvertretung eine politisch problematische Ausgangssituation mit bewirtschaftet. Solche Rückfragen müssen wir uns stellen, auch im Rahmen der sogenannten strategischen Prozesse. Im Praxisalltag allerdings müssen wir als Anwält:innen diese Fragen oft ignorieren, um für die direkt vom Recht Betroffenen handLungsfähig zu bleiben.
Sehe ich richtig, dass du vor dem Hintergrund des Rechts als Herrschaftsverhältnis auch die Grenzen der politisch-emanzipatorischen Möglichkeiten des Rechtsstreits erkennst?
Zivilgesellschaft als Motor für gerechtes Recht
TAREK NAGUIB: Natürlich gibt es diese Grenzen. Mir geht es aber nicht in erster Linie um die unmittelbaren Wirkungen des Rechts auf Gesetze, sondern um die Frage, wo Rechtsprozesse gesellschaftliche game changer waren. Wir sollten uns vermehrt fragen: Was heisst es, mit Recht die Gesellschaft zu bewegen, und etwas gegen Unrecht zu unternehmen? Und was sind die Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit dies erfolgreich gelingt? Das Ziel sollte sein, dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, zum Beispiel aus Politik, sozialer Arbeit, Kunst, Bildungsarbeit und den Wissenschaften durch Rechtsverfahren angesprochen werden, um mit ihren Möglichkeiten und in ihrem Umfeld Ideen für kreative Projekte zu entwickeln. Zu strategischen Verfahren gehört auch zu lernen, dass sie einen langen Atem brauchen und mit Fort- und Rückschritten verbunden sein werden. Das European Roma Rights Centre beispielsweise konnte durch eine Serie von Rechtsverfahren, die sie über Jahre bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führten, europaweit Erfolge im Widerstand gegen Segregation von Romni an Schulen erwirken. Auch wenn einige dieser Fälle juristisch in Fachzeitschriften als Rückschläge beschrieben wurden, da sie den diskriminierenden Status quo zementierten, haben sie insgesamt dem Kampf gegen Antiziganismus europaweit mehr Kraft verliehen.
FANNY DE WECK: Ich bin mit dir einverstanden. Auch mir scheinen der Aufbau und die Stärkung einer politischen Bewegung durch einen Rechtsstreit weitaus wichtiger als Artikel in juristischen Fachzeitschriften, wonach ein Urteil als juristischer Rückschlag zu werten sei. Letztlich sind da unsere Positionen gar nicht weit auseinander – wir stecken einfach in anderen Realitäten, vor allem in Bezug auf das Ziel eines Rechtsstreits. Dabei müssen wir zwischen dem Rechtsstreit als Lösung politischer Fragen einerseits und als Mittel des politischen Kampfs andererseits unterscheiden. Bei Ersterem bin ich eher skeptisch, Letzteres kann durchaus sinnvoll sein. Zusammengefasst ist Recht weder per se emanzipatorisch noch a priori unterdrückend. Wie bei allen staatlichen Institutionen müssen wir stets für die progressive Ausrichtung des Rechts kämpfen: für den Charakter des Rechts.
Gemeinsame Nachbemerkung
Hoffentlich hat dieses Gespräch einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen des Rechtwegs als politisches Mittel gegeben. Dank unseres Austauschs haben wir uns gegenseitig ein wenig verunsichert, weil wir die Position und Argumentation des anderen vor seiner jeweiligen Ausgangslage und Denkweise durchaus nachvollziehen können. Ohnehin sind wir beide der Ansicht, dass es wenig sinnvoll ist, klassischen Rechtsschutz und politische oder strategische Prozessführung klar abzugrenzen, geschweige denn gegeneinander auszuspielen. Jeder Fall, jede Beschwerdeführerin, jede Rechtslage ist von eigener Art. Und manchmal löst ein Fall politisch weit weniger aus, als man ihm ursprünglich zugesprochen hat, während ein anderer Fall politische Lawinen auslöst, obwohl man dies nicht erwartet hätte.
Letztlich kämpfen wir beide sowohl mit juristischen Mitteln als auch mit klassischer politischer Arbeit für eine inklusives und progressives Recht. Uns ist klar, dass die Justiz hier nicht reicht. So setzen wir uns gemeinsam etwa in einem neuen Verein namens Aktion Vierviertel für einen Paradigmenwechsel im Schweizer Bürgerrecht ein. Um hier vorwärts zu kommen, werden wir alle Mittel nutzen, die wir kennen – wer weiss – vielleicht sehen wir uns vor Gericht!
Informationen zu den Autor:innen
FANNY DE WECK ist Rechtsanwältin bei RISE Attorneys at Law in Zürich mit Schwerpunkt Straf- und Migrationsrecht sowie internationale Individualbeschwerdeverfahren. Sie doktorierte zum Non-Refoulement-Prinzip in internationalen Beschwerdeverfahren an der Universität Luzern, wo sie aktuell Lehrbeauftragte für Öffentliches Recht ist. Fanny de Weck publiziert und doziert regelmässig zu ihren Fachgebieten und berät NGOs und andere Juristinnen. Sie ist politisch vielseitig engagiert, unter anderem ist sie Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Aktion Vierviertel, der sich für einen Paradigmenwechsel im Schweizer Staatsbürgerschaftsrecht einsetzt.
TAREK NAGUIB ist Jurist, forscht und lehrt an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW mit Schwerpunkt im Antidiskriminierungsrecht. Zu seinen Themen gehören Critical Race Theory, Legal Disability Studies und Legal Gender Studies. Er ist Mitbegründer von INES und des Schweizer Netzwerks für Diskriminierungsforschung SNDF sowie des Vereins Aktion Vierviertel. Ausserdem engagiert er sich als Aktivist in der Allianz gegen Racial Profiling und begleitet strategische Rechtsverfahren gegen strukturelle Diskriminierungen. Er ist Mitherausgeber des jüngst erschienen Readers Racial Profiling. Struktureller Rassismus und antirassistischer Widerstand (2019).